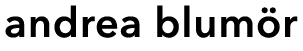Was mich zu dieser Frage motiviert hatte, war der mediale Bruch (so mochte ich ihn einfach mal nennen, nicht werten) in Deiner Vorgehensweise. Du beginnst mit einem reproduktiven Schritt, indem Du Deine Vorlage projizierst und wechselt dann in in eine fast diametral entgegengesetzte Technik, die klassische Malerei. Dieser Schritt interessiert mich. Ich würde dies durchaus als einen reflexiven Schritt interpretieren, als eine Auseinandersetzung mit der Malerei unter der Bedingung der neuen, der reproduktiven Medien. Würdest Du hierin folgen?
Ja, durchaus. Allerdings habe ich mir das nicht als Teil eines Konzeptes ausgedacht, es hat einfach technisch zu dem gepaßt, was ich machen wollte. Das das im 21. Jahrhundert funktioniert, hat natürlich die Vorbedingungen, die Du aufführst: Ein Wissen über die alte Technik und die Möglichkeit, neue Technik zu kennen und nutzen zu können, was nun bei einem Overheadprojektor 2006 nicht so abgefahren ist. Wenn Du aber hier noch mal genau fokusierst, sehe ich durchaus die Dimension, die zu einer Haltung wird. Diese Haltung hat für mich eher etwas „natürliches“, im Sinne von unbewußt. Ich nehme mir eine Idee genauer vor und überlege, wie ich die umsetzen kann, ganz technisch, mit einem Bewusstsein von Qualität. Möglicherweise ist das auch ein handwerkliches Denken, das wieder mit „Tradition“ verwurschtelt ist. Aber ohne den romantischen Touch, den das oft hat.
Das bestätigt aber durchaus meine Theorie, besser meine Interpretation Deiner Bilder. Es gibt hier sogar eine gewisse Nähe zu Bildern Gerhard Richters in den 1960er Jahren, den sog. ‚Übermalungen‘, in denen er Fotografien vergrößert auf Leinwände malt, die Bilder aber durch Verwischungen verfremdet und so den Eigenwert der Malerei hervorhebt, also das herausarbeitet, was der Malerei gegenüber der Fotografie eigen bleibt. Für mich ein Bekenntnis zur Malerei in einer Zeit, die das Ende der Malerei beschwört. Wäre diese Parallele für Dich evident oder würdest Du sie eher ablehnen?
Nun, im Grunde ist diese Frage für mich nicht so wichtig. Zum einen, weil ich die Rivalität von Fotografie und Malerei gar nicht so verinnerlicht habe, zum anderen weil ich nicht das Gefühl habe, ich müßte die Malerei verteidigen, behaupten oder immer wieder neu begründen. Ich kann wenig damit anfangen, wenn man Malerei oder Fotografie sagt, ist es nicht eher ein ganz anderer Gegensatz, der da Sinn machen würde: Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und polarisiere: Dekoration oder Inhalt. Wir sagen ja auch nicht ein Holzstuhl ist besser als ein Metallstuhl, also Schreinerarbeit ist fundamentaler als Metallarbeit, weil es früher möglich war, Holz zu bearbeiten. Zumal haben sich Fotografie und Malerei doch immer auch befruchtet. Was ich im Übrigen auch bei den Bildern von Richter gedacht habe, also eher ein Dialog, als eine Neubehauptung.
Nun, ich würde auch nicht von einer Rivalität zwischen Malerei und Fotografie sprechen, eher von einem sich Bewußtwerden, einem Reflektieren der jeweils eigenen medialen Möglichkeiten. Aber brechen wir hier ab und wechseln ein wenig den Fokus. Als Resümee möchte ich aber festhalten, das ich, auch wenn es für Dich selber nicht diese Bedeutung, diese Wertigkeit hat, Deine Bilder auch oder vor allem, das wäre noch zu klären, als eine reflexive Auseinandersetzung der Malerei mit den ihr eigenen Bedingungen und Traditionen lese. Kommen wir zu einem anderen Punkt: Du weist in unseren Gesprächen aber immer wieder darauf hin, wie wichtig Dir der Bezug auf die außerbildnerische Wirklichkeit ist. Könntest Du das etwas näher erläutern?
Dieser Bezug hat mehrere Ebenen. Ganz praktisch benutze ich Relikte, so hatten wir das im ersten Gespräch genannt, die tatsächlich existieren und eine Bedeutung als solche hatten, also nicht von vornherein als Modelle für Malerei gedacht waren, sondern tatsächliche Fahrkarten oder Einreisestempel sind. Die Tatsache, dass sie eine Funktion hatten, beinhaltet auch, dass es ein Ereignis gegeben hat, für das dieses Relikt steht. Es hat also einen narrativen Charakter und wie bereits erwähnt, ist dieses Ereignis für mich die Triebfeder, mir soviel Arbeit zu machen. Zum anderen ist es ein Verweis darauf, dass hier mehrere Menschen etwas getan haben, einen Stempel entworfen, eine Notiz gemacht, eine Einreisegenehmigung erteilt, was auch immer. Das ist für mich der Verweis auf eine Welt, die stattfindet, die auch nur als Gesellschaftlichkeit stattfindet und stattfinden kann, von der ich Teil bin. Und das verweist natürlich auf eine künstlerische Position, die nicht allgemein gültig ist, die ich aber auch nicht erfunden habe.
Würde ich zu weit gehen, wenn ich damit Deinen malerischen Akt als Teil eines künstlerischen Prozesses verstehe, der vor dem Bild, ja noch vor Deinem Dazukommen beginnt, den Du sozusagen aufnimmst und über das Bild, über das Schaffen des Bildes weiter führst? Und geht dieser Prozeß dann im Betrachter weiter, an diesen über?
Ja, im Prinzip ja. Ob es allerdings im Betrachter einen Widerhall gibt, liegt wohl an unterschiedlichen Gründen und entzieht sich meiner Kontrolle.
Das ist dann eine Frage der Rezeption, der rezeptiven Offenheit Deiner Bilder, auf die ich später noch mal zurückkommen möchte. Meine Frage hier bezieht sich zunächst einmal auf Dein künstlerisches Selbstverständnis und den damit verbundenen Werkbegriff. Also anders gefragt: schließt Du diese Offenheit der Rezeption konzeptionell mit ein, ist sie ein konstitutiver Teil Deines Werkbegriffes, wie auch die Gestaltung der Vorlage, die Du übernimmst, die ja etwas Vorgefundenes ist, dem der Gestaltungswillen, die Handschrift eines Unbekannten eigen ist.
Ja. Es ist in gewisser Weise eine Arbeitsteilung. Wobei die, die zuvor beteiligt waren, nicht mitreden können. Aber das ist bei den Produzenten von Autos ja auch so.
Du hast im ersten Teil unseres Gespräches gesagt, dass Deine Vorlagen sich immer auf ein konkretes Ereignis beziehen, also für Dich immer über diese Vorlage ein referentieller Bezug auf dieses Ereignis besteht. Ich verstehe Dich richtig, dass dieser Bezug konstitutiv für Dein künstlerisches Verständnis ist, oder anders gefragt, eine Vorlage, die keinen solchen Bezug hat, genauer: deren ‚Geschichte‘ Dir nicht bekannt ist, käme für Dich nicht in Frage?
Doch, es gibt ein paar Zettelchen, die ich einfach auf der Strasse gefunden habe. Ich kenne also den Hintergrund dieser Zettel nicht, sie sind aber spannend genug, dass ich mir selber Geschichten dazu erfinden kann, die mehr oder weniger realistisch sind. Im Allgemeinen finde ich bei Geschichten , die man sich so erzählt, den Wahrheitsgehalt zweitrangig, wichtiger dabei ist mir der „Realitätssinn“. Einige BetrachterInnen haben mir auch schon Zettelchen angeboten, die ich aber immer, bis auf ein mal, abgelehnt habe. Das Zettelchen habe ich dann eine Weile mit mir rum geschleppt und schließlich die Rückseite benutzt.
Dann gibt’s Du auch den Betrachtern Deiner Bilder die Freiheit, sich, unabhängig von den tatsächlichen Hintergrundgeschichten, eigene Geschichten bei der Betrachtung Deiner Bilder zu ersinnen, d.h. die tatsächliche Geschichte hinter dem Bild ist für das Verständnis des Bildes nicht konstitutiv, wichtig ist vielmehr der ’narrative Impuls‘, den das Bild beim Betrachter auslöst. Sehe ich das so richtig?
Ja, klar. Es geht nicht mehr um die Geschichten, wenn das Bild fertig ist! Da geht es darum, dass es Geschichten erzählt, erzählen kann und Anstösse bietet. Bei der letzten Ausstellung meinte jemand, der Einkaufszettel (ja, sie haben alle keine Titel, aber irgendwie muss ich das ja jetzt benennen) erinnere sie an das eigene Durchstreichen, aber an unterschiedliche Gefühle, das befriedigende Gefühl Teile der to-do Liste zu streichen, wenn sie was erledigt hat, und das unangenehme Gefühl, Textpassagen zu streichen, weil sie nicht gelungen sind. Na, wunderbar, da hat sie nicht nur festgestellt, dass sie so was schon mal gesehen hat, sondern, es als tägliche Handlung wieder erkannt. Könnte das vielleicht ein Schritt in die Alltäglichkeit Kunst sein?
Würden die Geschichten wirklich so im Vordergrund stehen, würde ich gar nicht malen, sondern das Zettelchen an die Wand hängen. Wäre die Originalgeschichte das Wesentliche, würde ich nicht mal das Zettelchen an die Wand hängen, sondern die Geschichte gleich aufschreiben oder noch besser erzählen. Bei einigen Bildern läßt sich ja auch nur noch erahnen, was es mal war. Da ist die Geschichte der Malerei zum Opfer gefallen.
Ich möchte es einmal so formulieren: banale Objekte des Alltages, denen wir ansonsten nur einen Gebrauchswert zubillligen, werden durch die künstlerische Transformation selbstreferentiell: Kunst wird nicht zur Alltäglichkeit, sondern läßt uns Alltäglichkeiten bewußt werden. Also eine Position, wie sie auch die Pop-Art vertritt.
Das ist selbstverständlich genau richtig. Allerdings ist es auch eine Frage der Perspektive, sprich, ob Du von dem Alltag losgehst oder von der Kunst.
Ich komme noch mal auf Deine oben getroffene Definition von ‚Erzählung‘ zurück, die nicht ‚wahr‘ sein, aber dem Realitätsprinzip verpflichtet sein müsse. Mir fällt in diesem Zusammenhang die Unterscheidung von ‚Wirklichkeitssinn‘ und ‚Möglichkeitssinn‘ ein, wie sie Robert Musil in seinem „Mann ohne Eigenschaften“ trifft. Ich darf sie kurz zitieren:
«Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezweifeln, daß er seine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann. Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen; sondern er erfindet: Hier könnte, sollte oder müßte geschehn; und wenn man ihm von irgend etwas erklärt, daß es so sei, wie es sei, dann denkt er: Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebensogut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist.»
Kannst Du mit dieser Unterscheidung etwas anfangen?
Ja, damit kann ich was anfangen. Ich habe allerdings noch nie Musil gelesen. Ich fühle mich da Zora Neale Hurston näher, die bekannt war Geschichten nicht immer so nah an der Wahrheit zu erzählen. Nun, sie hat oral history betrieben, als es diesen Begriff dafür noch gar nicht gab. Sie hat Geschichten von ehemaligen Sklaven auf Bahamas und den Südstaaten der USA gesammelt. Aber auch Romane geschrieben, für die sie von einigen der (männlichen) Vertretern der Harlem Renaissance gedißt wurde. Ich will sie hier nicht komplett rehabilitieren, sie ist später ziemlich konservativ geworden, allerdings ist sie so arm gestorben, wie sie geboren wurde. Für mich liegt eher der Unterschied hier: wenn ich ehrlich bin und mich auf meine Erinnerung verlasse, um eine Geschichte zu erzählen, vergesse ich doch schnell mal einen Aspekt oder oder stelle ihn falsch dar. Also gehe ich doch besser gleich davon aus, dass die Geschichte so oder so ähnlich stattgefunden hat. Zumal halte ich das Interesse dessen, der da erzählt für viel wichtiger.
Essen, 2006, Thomas Hammacher im Gespräch mit Andrea Blumör