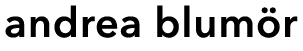Als ich ein kleiner Junge war, begann ich die Kölner Bucht mit dem Fahrrad zu erkunden. Endlose Felder von Zuckerrüben, die sich auf dem fruchtbaren Lössboden der von der letzten Eiszeit flachgeschliffenen Ebene zwischen Köln und Aachen erstrecken. Schon als Kinder hatten uns unsere Eltern gezeigt, wie sich die reifen Zuckerrüben aufschneiden lassen, um durch Kauen auf den Rübenschnitzen die Süße ihres Zuckers zu schmecken. Damals gab es noch überall kleine Zuckerfabriken, die an ihrem süßlichen Gestank schon aus der Ferne zu erkennen waren. Da unsere Eltern, die fünf Blagen durchfüttern mussten, uns schon früh an Rübenkraut als Brotaufstrich gewöhnt hatten, wusste ich, dass vor dem reinen weißen Kristallzucker eine herrlich klebrige dunkelschwarze Masse steht.
Aber ich wusste damals nicht, dass sich das Farbspiel von Weiß und Schwarz auf ganz andere Weise historisch in diese Landschaft eingebrannt hatte. Denn die ausgedehnte Monokultur der Zuckerrübe verdanken wir der haitianischen Revolution. Kein Mensch denkt heute bei Spaziergängen durch die Kölner Bucht an Haiti, an revoltierende Sklaven, an schwarze Sklavinnen, die ihr aus Afrika mitgebrachtes botanisches Wissen dafür verwandten, ihre weißen Sklavenhalter zu vergiften. Und doch hätte es ohne diese erste und einzige erfolgreiche Revolution von Versklavten, die von 1792 bis 1804 andauerte, keine Zuckerrübe gegeben.
Was für uns heute vernachlässigbar billige Produkte des täglichen Konsums sind – Zucker, Kaffee oder Baumwolle – waren im Frühkapitalismus des 17. und 18. Jahrhunderts die profitabelsten Motoren des globalen Handels und des Siegeszug der Kapitalakkumulation, der Entwicklung eines neuartigen kapitalistischen Weltsystems. Zucker und Kaffee waren damals völlig neue und atemberaubende Genuss- und Aufputschmittel, die rasch in den Massenkonsum eindrangen.
Ohne diese anregenden „Kolonialwaren“ hätte es keine Aufklärung und keine französische Revolution gegeben. Wo wären die großen Denker der Aufklärung ohne ihre Dispute in tabakverqualmten Kaffeehäusern? So sehr auch Rousseau und andere das Bild des überall in Ketten liegenden versklavten Menschen für die Propaganda ihrer Idee der angeborenen Menschenrechte gebrauchten – die leibhaftigen Sklaven, die von den afrikanischen Gestaden in die Karibik verschleppt worden waren, um dort auf riesigen Plantagen die materiellen Rohstoffe für hochgeistige Diskussionen in Paris, Amsterdam oder London zu produzieren, waren damit nicht gemeint – und schon gar nicht die Frauen.
Etwa ein Drittel der 12,5 Millionen Menschen, die in den vier Jahrhunderten des aufsteigenden Kapitalismus auf Sklavenschiffen in die Neue Welt gebracht wurden, waren Frauen. Von den 12,5 Millionen überlebten nur 10,5 Millionen die Seereise.
Als sich in der größten und reichsten Kolonie der damaligen Welt, dem französischen St. Domingue auf der Insel Hispaniola, ab 1792 die Sklavinnen und Sklaven erhoben, ihre weißen Herren und Herrscherinnen umbrachten und die Zuckerrohrfelder auf den Plantagen niederbrannten, wurde in Europa der Zucker knapp. Die ärmeren Bevölkerungsschichten gingen in Paris auf die Straße, nicht um nach Brot zu verlangen, sondern nach niedrigeren Zuckerpreisen. Und so kam schließlich die Zuckerrübe in die Kölner Bucht – die rebellischen Sklavinnen und Sklaven der Karibik hatten die Herrschenden in Europa gezwungen, in eine eigene, sehr viel unproduktivere Zuckerpflanze zu investieren.
Und dem Farbenspiel des Rassismus erteilten sie eine Abfuhr, wie sie keinem der großen Helden der Aufklärung je in den Sinn gekommen wäre. Sie bestimmten in der Verfassung ihres neuen Staats Haiti, dass ab sofort alle Menschen schwarz sind.
Aber Mehl?
Das gibt es doch schon viel länger als Zucker. Steht es nicht für die dörfliche Idylle, wo der Bauer das Feld pflügt, während die Töchter das Brot backen? So wie in der Idylle der heutigen Hausfrau. „Wie lieb, dass du Kuchen für uns bäckst. Ach Schatz, du hast da etwas Mehl im Gesicht!“ Wie süß.
Mehl ist auf Staubkorngröße zerkleinertes Getreide. Getreide wurde im Neolithikum zu einem Grundnahrungsmittel – also mit der Vertreibung aus dem Garten Eden und der Verbannung auf die Felder, die zu bearbeiten waren. Dieses bornierte Festsetzen auf einem Stück Boden – das sogenannte Sesshaftwerden, das immer noch an Haft erinnert – markierte die Entstehung einer doppelten Herrschaft: der Klassengesellschaft, in der eine Minderheit die Mehrheit für sich arbeiten lässt, sie ausbeutet – und die Herrschaft der Männer über die Frauen. So wurde es auch gleich einleitend im Gründungsdokument unserer jüdisch-christlichen Leitkultur festgeschrieben: Mühselig sollst du im Schweiße deines Angesichts dein Brot verdienen – und die Frauen sollen unter Schmerzen gebären und dem Manne untertan sein.
Mehl erzählt auch eine Geschichte.
Das Korn muss noch gemahlen werden. Die Mühle ist das große Vorbild der modernen Industrie. Im Englischen hieß die Fabrik „mill“. Und historisch lieferte er sinnig ausgedachte Mechanismus für die Zerkleinerung des Korns, mit Wasser oder Wind oder der Hand angetrieben, die Vorlage für das Disziplinierungsmittel, mit dem im Frühkapitalismus vagabundierende und bettelnde Frauen und Männer zur Arbeit erzogen werden sollten: die Tretmühle in den Zucht- und Arbeitshäusern, die im 17. und 18. Jahrhundert überall in Europa entstanden, mit der nicht sinnvolles produziert wurde, außer den dressierten Körpern.
Mehl, Zucker, Baumwolle, Sand, Kaffee, Wasser … Stoffe, die gerade in ihrer Alltäglichkeit eine Geschichte erzählen, und deren Alltäglichkeit zugleich diese Geschichte verschleiert.
Wir suchen ständig nach Ausdrucksformen, mit denen wir ihre Geschichte entschleiern können. Aber es bleiben immer wir, die wir heute auf diese Geschichte schauen. Und wir versuchen uns einen Reim darauf zu machen, was daran unsere Geschichte ist, oder wer wir sind, in unserer Geschichtlichkeit.
„Wer ist denn kein Sklave? Sagt mir das!“ lässt Hermann Melville seinen Ismael in Moby-Dick sagen, der auf einem Walfänger-Schiff anheuert, einer dieser frühkapitalistischen Fabriken, die Öl produzierten, bevor wir Löcher in den Wüstensand bohren und mit ihnen die letzten Nomaden vertreiben konnten.
Wo stehen wir? Schauen wir nur auf eine grauenvolle Geschichte zurück, oder spiegelt sie unser eigenes Elend. Welche Tretmühlen hat man für uns aufgestellt, und können wir ihnen mit der Kunst entfliehen?
Der arroganten Eitelkeit des Fortschritts, die sich zur Selbstvergewisserung des Rückblicks auf eine düstere Vergangenheit bedient, hatte Walter Benjamin entgegengehalten: Die Katastrophe ist nicht das, was auf uns zukommt, die Katastrophe ist, dass es so weitergeht, wie es ist.
Vielleicht sollten wir so unsere Beziehung zu Geschichte denken, als ständige Erinnerung an das, was längst noch nicht eingelöst ist. Das Bild einer schönen Baumwollpflanze im lauen Wind könnte uns daran erinnern, dass jedem Stück Baumwollstoff, das wir heute an unserem Leib tragen, immer noch der süße Leichengeruch jener „merkwürdigen Früchte“ anhaftet, von denen Billie Holiday so schmerzhaft singt.